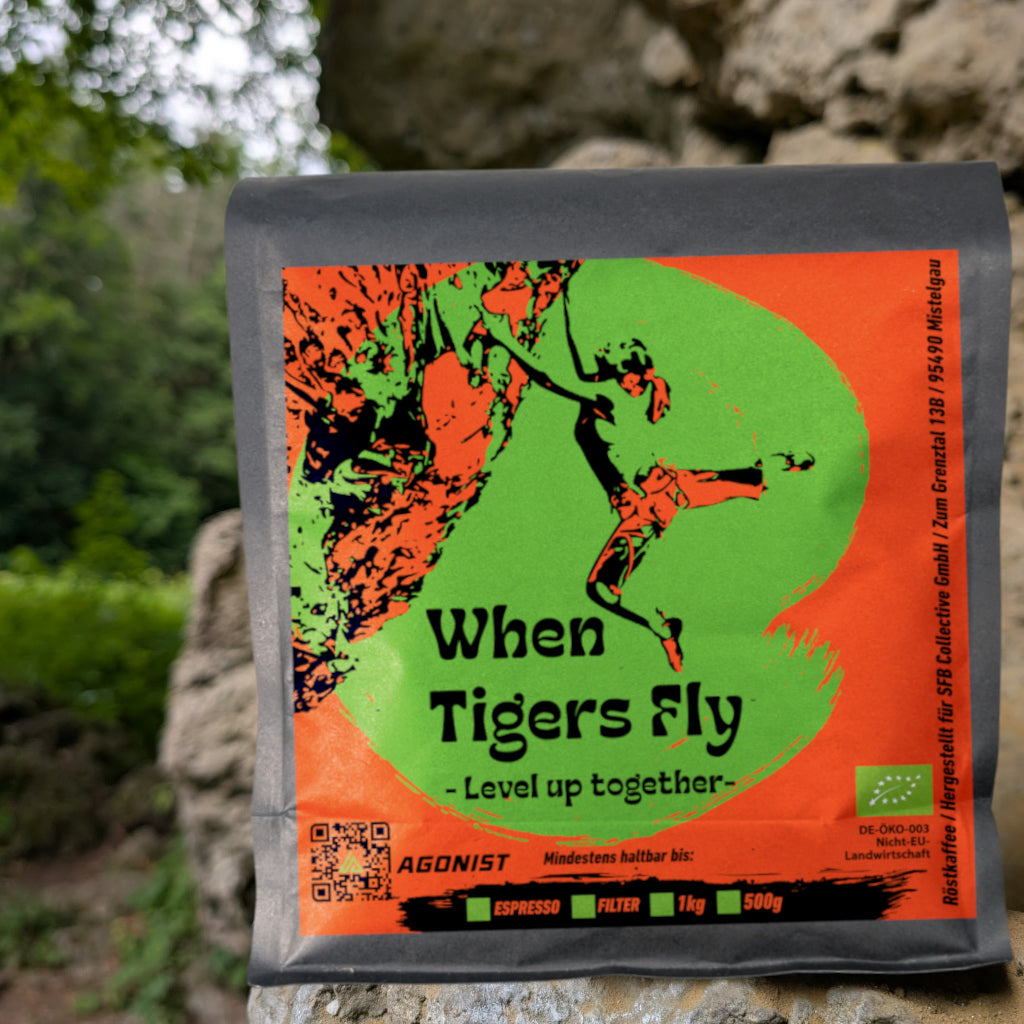Rotpunkt klettern: Alles zur Geschichte, Bedeutung & Begehungsstilen
Das Rotpunkt-Klettern steht wie kein anderer Begriff für den ethischen Standard im modernen Sportklettern. Was mit einem simplen roten Punkt im Frankenjura begann, entwickelte sich zur weltweit anerkannten Norm für frei gekletterte Routen. In diesem umfassenden Guide erfährst du alles über die Geschichte, Bedeutung und Varianten des Rotpunkt-Kletterns – inklusive Trainingstipps und der perfekten Verbindung von Kaffee und Kletterkultur.
Was ist Rotpunkt klettern? Definition & Herkunft
Rotpunkt klettern bezeichnet das freie Durchsteigen einer Route im Vorstieg, ohne Belastung der Sicherungskette und ohne Sturz. Der Kletterer darf die Route vorher beliebig oft ausprobieren und einstudieren – entscheidend ist der vollständige Durchstieg in einem Zug. Die Zwischensicherungen müssen dabei alle selbst angebracht werden, was den Stil vom lockeren Pinkpoint (Sicherungen sind alle schon angebracht) unterscheidet.
Die Geburtsstunde des Rotpunktens liegt im Frankenjura der 1970er Jahre. Der visionäre Kletterer Kurt Albert markierte Routen, die er frei ohne Zuhilfenahme der Haken geklettert hatte, mit einem roten Punkt. Diese einfache Idee revolutionierte die Kletterethik weltweit und läutete das Ende des "Eisenzeitalters" (technisches Klettern mit Hilfsmitteln) ein.
Die Geschichte des Rotpunkt-Kletterns
Kurt Albert und die Frankenjura-Revolution
Kurt Albert war gelangweilt vom technischen Klettern mit Trittleitern und Haken als Aufstiegshilfen. Inspiriert von den Kletterregeln der Sächsischen Schweiz und den Entwicklungen in den USA begann er, bisher technisch begangene Routen im puren Freikletterstil zu begehen. Jede erfolgreich frei gekletterte Route markierte er mit einem roten Punkt – das Rotpunkt-Prinzip war geboren.
Die Idee verbreitete sich rasch in der internationalen Kletterszene. Während die ältere Generation zunächst skeptisch war, setzte sich die junge, athletische Herangehensweise schnell durch. Heute ist Rotpunkt der weltweite Standard für das Begehen von Sportkletterrouten.
Wolfgang Güllich und die nächste Generation
Wolfgang Güllich, ebenfalls im Frankenjura beheimatet, trieb das Rotpunkt-Klettern in den 1980er Jahren auf ein neues Niveau. Seine Erstbegehungen wie "Action Directe" (weltweit erste 11 UIAA) setzten neue Maßstäbe für Schwierigkeit und Trainingsmethodik. Güllich verkörperte die Verbindung von athletischem Klettern und philosophischem Tiefgang – eine Tradition, die bis heute im Frankenjura lebendig ist.
Begehungsstile im Detail: Von Onsight bis Headpoint
| Begehungsstil | Beschreibung | Schwierigkeitsgrad |
|---|---|---|
| Onsight | Route im ersten Versuch ohne Vorwissen | Höchste Anforderung |
| Flash | Erster Versuch mit Informationen | Sehr anspruchsvoll |
| Rotpunkt | Eingeübter Durchstieg | Standardbewertung |
| Pinkpoint | Rotpunkt mit hängenden Expressen | Sicherer |
| Headpoint | Eingeübte Trad-Route ohne Sturzmarge | Psychisch fordernd |
Onsight: Die Königsklasse
Ein Onsight gelingt, wenn du eine Route im ersten Versuch ohne jegliche Vorinformationen durchkletterst. Nur vom Boden aus sichtbare Informationen sind erlaubt. Dies ist die prestigeträchtigste Form des Kletterns – vergleichbar mit einer perfekten Interpretation eines unbekannten Musikstücks. Die weltweit schwersten Onsights bewegen sich im Bereich 9a (durch Alex Megos und Adam Ondra).
Flash: Erster Versuch mit Wissen
Beim Flash kletterst du die Route ebenfalls im ersten Versuch, darfst aber alle verfügbaren Informationen nutzen: Du kannst andere Kletterer beobachten, dich über Griffe und Tritte informieren oder Videos studieren. Ein Flash ist weniger wertvoll angesehen als ein Onsight, aber höher bewertet als ein eingeübter Rotpunkt.
Rotpunkt: Der eingespielte Durchstieg
Die Rotpunkt-Begehung ist der Standard für das Projektieren schwieriger Routen. Du studierst die Bewegung, übst einzelne Passagen und steigerst dich langsam bis zum vollständigen Durchstieg. Diese Methode ermöglicht es, nahe an deine absolute Leistungsgrenze zu gehen.
Rotpunkt vs. andere Kletterstile
Technisches Klettern (Aid Climbing)
Vor der Rotpunkt-Ära dominierte das technische Klettern: Kletterer verwendeten Haken, Trittleitern und mobile Sicherungsgeräte zur Fortbewegung. Heute wird Aid Climbing mostly nur noch in großen Wänden eingesetzt, wo Freiklettern unmöglich ist.
Free Solo: Ohne Sicherung
Free Solo bedeutet Freiklettern ohne jegliche Sicherung. Dieser extrem gefährliche Stil hat mit Rotpunkt nur die Bewegungstechnik gemein – die psychologische Komponente ist unvergleichbar höher. Jeder Fehler endet meist tödlich.
Bouldern: Klettern in Absprunghöhe
Bouldern ist Klettern ohne Seil in Absprunghöhe mit Crashpads als Absicherung. Die Bewegungen sind oft kraftbetonter als beim Seilklettern, und die Routen (sogenannte "Probleme") sind kürzer. Viele Kletterer kombinieren Bouldern und Rotpunkt-Training für optimale Fortschritte.
Ausrüstung zum Rotpunkt-Klettern
Die Grundausstattung fürs Rotpunkt-Klettern umfasst:
-
Kletterschuhe: Präzise passend für maximale Performance
-
Klettergurt: Leicht und bequem für lange Tage am Fels
-
Kletterseil: 50-70m Länge für moderne Sportkletterrouten
-
Expressschlingen: 8-16 Stück für die Zwischensicherungen
-
Magnesium: Für bessere Haftung an heißen Tagen
-
Kaffee Kult: Hochwertiger Kaffee für die Konzentration vor der Projektroute
Rotpunkt im Frankenjura & weltweit
Der Frankenjura bleibt das Herzstück der Rotpunkt-Bewegung. Mit bis zu 10.000 Routen und Boulder auf engstem Raum, bietet die Region alles von gemütlichen Klettergärten bis zu world-class Projekten. Berühmte Sector wie das Waldklettergebiet Streitberger Schild (wo Kurt Albert den ersten roten Punkt malte) oder die spektakulären Felsen der Unteren Trubach ziehen Kletterer aus aller Welt an.
Aktuelle Superstars wie Alex Megos (Erlangen) setzen die Tradition fort und projektieren im Frankenjura Routen bis zum Schwierigkeitsgrad 9b+. Die Mischung aus rauem Kalkstein, anspruchsvollen Bewegungen und lebendiger Kletterkultur macht die Region einzigartig.
Trainingstipps fürs Rotpunkt-Klettern
-
Projektieren lernen: Teile Routen in Abschnitte, übe einzelne Moves und verbinde dann die Sequenzen
-
Kraft-Ausdauer trainieren: 4x4-Intervale oder Zirkeltraining an der Kletterwand
-
Mental training: Visualisierungstechniken für kritische Stellen
-
Erholung managen: Ausreichend Pausen zwischen Versuchen, gute Ernährung
-
Kaffee Kult nutzen: Ein qualitativ hochwertiger Kaffee vor der Session steigert die Konzentration ohne Nervosität und lässt dich kleinste Leisten halten.
FAQ: Häufige Fragen zum Rotpunkt-Klettern
Was bedeutet Rotpunkt genau?
Rotpunkt bedeutet, eine Route im Vorstieg ohne Sturz und ohne Belastung der Sicherungen zu klettern, nachdem man sie zuvor eingeübt hat.
Wer hat das Rotpunkt-Klettern erfunden?
Kurt Albert entwickelte das Konzept in den 1970er Jahren im Frankenjura, inspiriert von Kletterern in der Sächsischen Schweiz und den USA.
Was ist der Unterschied zwischen Onsight und Flash?
Onsight = erster Versuch ohne Vorwissen; Flash = erster Versuch mit Informationen über die Route.
Was braucht man zum Rotpunkt-Klettern?
Grundausrüstung: Schuhe, Gurt, Seil, Expressen, Magnesium. Für anspruchsvolle Projekte: Geduld, Trainingsplan und guter Kaffee für die Pausen.
Zusammenfassung & Ausblick
Das Rotpunkt-Prinzip hat das Klettern von einer technischen Aufstiegsmethode zu einer athletischen Kunstform transformiert. Was mit Kurt Alberts rotem Punkt begann, ist heute der globale Standard für sportliche Fairness und Leistungsvergleich im Klettersport.
Die Verbindung von körperlicher Herausforderung, mentaler Stärke und der Gemeinschaft in den Klettergebieten macht den Reiz des Rotpunkt-Kletterns aus. Und was passt besser dazu als eine Tasse Kaffee Kult nach der erfolgreichen Begehung einer Projektroute?
Wie schon Wolfgang Güllich sagte: " Man geht nicht nach dem Klettern zum Kaffeetrinken, Kaffeetrinken ist integraler Bestandteil des Kletterns!"
Die Entwicklung geht weiter: Kletterer wie Alex Megos oder Adam Ondra erfinden das Rotpunkt-Klettern immer wieder neu – mit höheren Schwierigkeitsgraden, besserer Trainingsmethodik und einer tieferen Verbindung zur Kletterkultur.